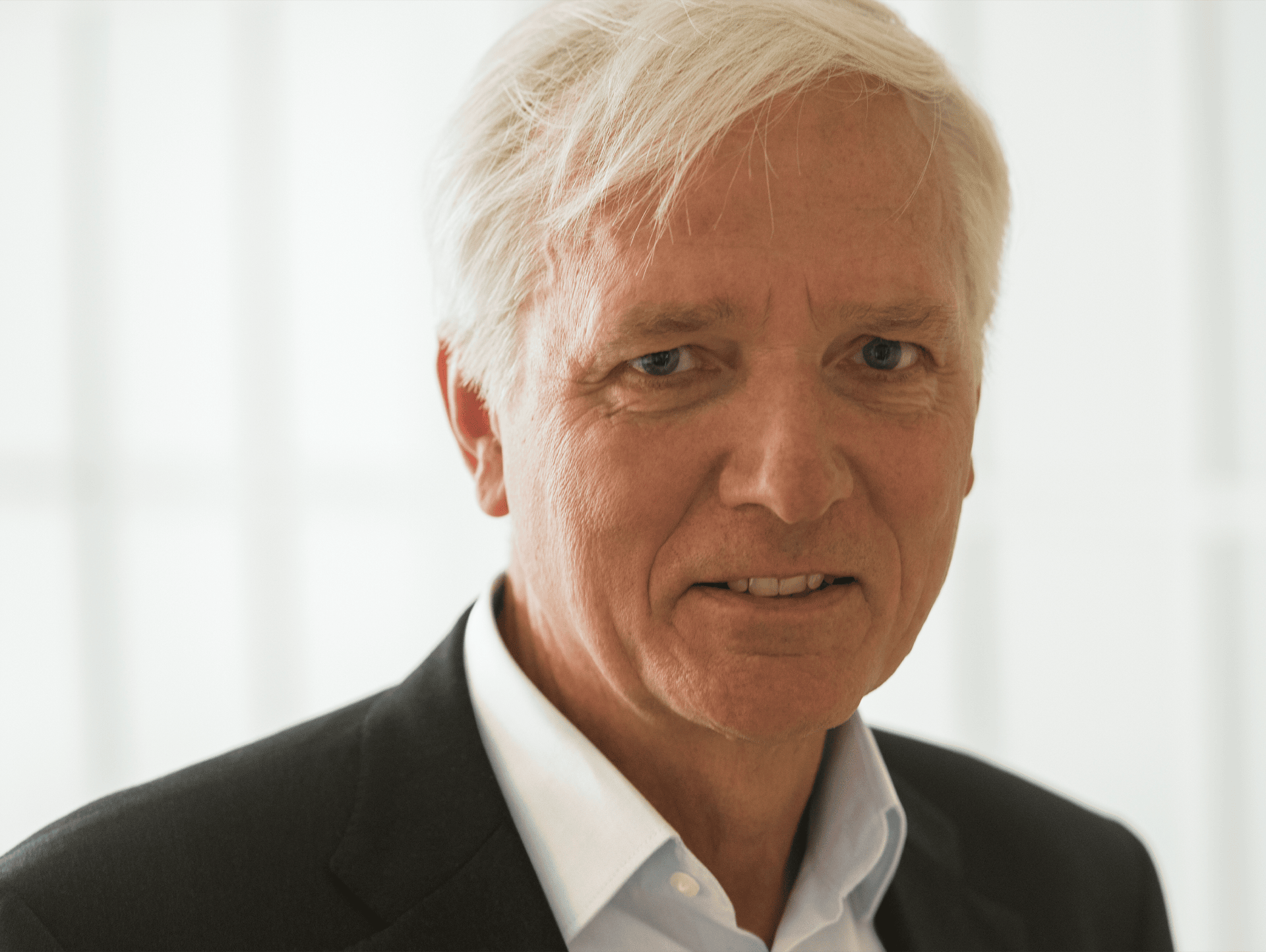Wie sehen Sie die Welt im Jahr 2050 und was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir eine Entwicklung, die die Erreichung der Ziele des Klimaabkommens von Paris (Agenda 2030) als notwendige Voraussetzung unterstellt und das giant leap Szenario
(in: Earth for all, 2022) als motivierenden Weckruf zum Handeln begreift.
Mehr noch. Ich bin bereit, durch Verhaltensänderung dafür leidenschaftlich einzutreten und andere zu motivieren, es mir gleichzutun. Dies umso mehr, da der erforderliche kulturelle
Wandel insb. durch exponierte Vertreter in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft glaubhaft beschleunigt werden muss.
Müsste ich ein Negativ-Szenario benennen, würde Jorgen Randers 2052 Global Forecast Realität.
Warum macht die Zukunft ein anderes Wirtschaften notwendig?
Die Erde und ihre, respektive unsere Ressourcen sind endlich. Das quantitative Wachstumsnarrativ wird durch Wiederholen nicht richtiger. Evidenzbasierte wissenschaftlich fundierte
Erkenntnisse lassen keinen Raum mehr für ein „Weiter so!“.
Erzählen Sie uns bitte von einem Schlüsselerlebnis, das Ihre Weltanschauung verändert hat.
Es gibt mehrere. Hervorheben möchte ich persönliche Begegnungen mit Dennis Meadows anlässlich der Vorstellung des 30-year update (2004 in Hamburg) und
Stéphane Hessel (Wofür lohnt es sich zu kämpfen?, Zukunftscamp 2012 der Zeit-Stiftung). Beide haben meine Zweifel an quantitativem Wachstum ad infinitum, an der
faktischen Unterordnung der res publica unter die Belange einer zusehends neoliberal ausgestalteten globalen Marktwirtschaft sowie und die Notwendigkeit, dazu auch
persönlich Stellung zu nehmen, maßgeblich beeinflusst.
Was sind die für Sie wichtigsten Parameter der qualitativen Oekonomie?
Output- und Ertragsparameter dürfen nicht gegen ESG-Parameter gestellt, sondern müssen integriert gedacht werden.
Denn: ein nachhaltiges Geschäftsmodell lässt in der Regel den höheren Ertrag erwarten. In welcher Höhe, zeitlichen Verteilung und Dauer dieser anfällt, sind Details, über die eine
intensive Reflexion erforderlich ist. Die qualitative Ökonomie adressiert diese Aspekte.Output- und Ertragsparameter dürfen nicht gegen ESG-Parameter gestellt, sondern müssen
integriert gedacht werden. Denn: ein nachhaltiges Geschäftsmodell lässt in der Regel den höheren Ertrag erwarten. In welcher Höhe, zeitlichen Verteilung und Dauer dieser anfällt, sind
Details, über die eine intensive Reflexion erforderlich ist. Die qualitative Ökonomie adressiert diese Aspekte.
Was sollten wir tun und was sollten wir lassen, um qualitative Oekonomie zu schaffen?
Lassen Sie es mich in Dos und Don’ts beantworten. Dos sind: strategische Entscheidungen stets mit einem vollständigen Set von (Handlungs-)Optionen zu unterlegen, eine
Präferenz immer anhand aller als relevant erkannten Kriterien zu bestimmen. Qualitative Kriterien, insb. aus dem ESG-Bereich, sind ein Muss. Und immer gilt auch
verstehen zu wollen, warum man die nicht präferierten Optionen ablehnt. Zudem geht es darum, entschlossen als nachhaltig richtig Erkanntes nicht nur umzusetzen, sondern auch
leidenschaftlich für Maß und Mitte einzutreten.
Die Don’ts lauten für mich: Tradierte Narrative zu wiederholen, die der Bewahrung des status quo dienen.
Publikationen von Dr. Roland Lappin
→ Kreditäre Finanzierung unter dem Grundgesetz – Ein Plädoyer gegen den Kreditstaat, Dissertation, 1994, in: Duncker & Humblot, Schriftenreihe zum öffentlichen Recht, Band 666
→ Wertbeitrag des Controllings in einem Wachstumsunternehmen, 2007, in: Erfolgstreiber für das Controlling, Hrsg. Péter Horváth
→ Post-Lehman: Bedarf der Einsatz des exzessiv neoliberalen Marktprinzips einer Neubewertung, oder?, 2021, in: https://www.nordakademie.de/news/In welchem Geist sehen wir das
Marktprinzip?